- Shop
- Leitungsclub
- Akademie
- Klett Kita Welt
- Neuheiten
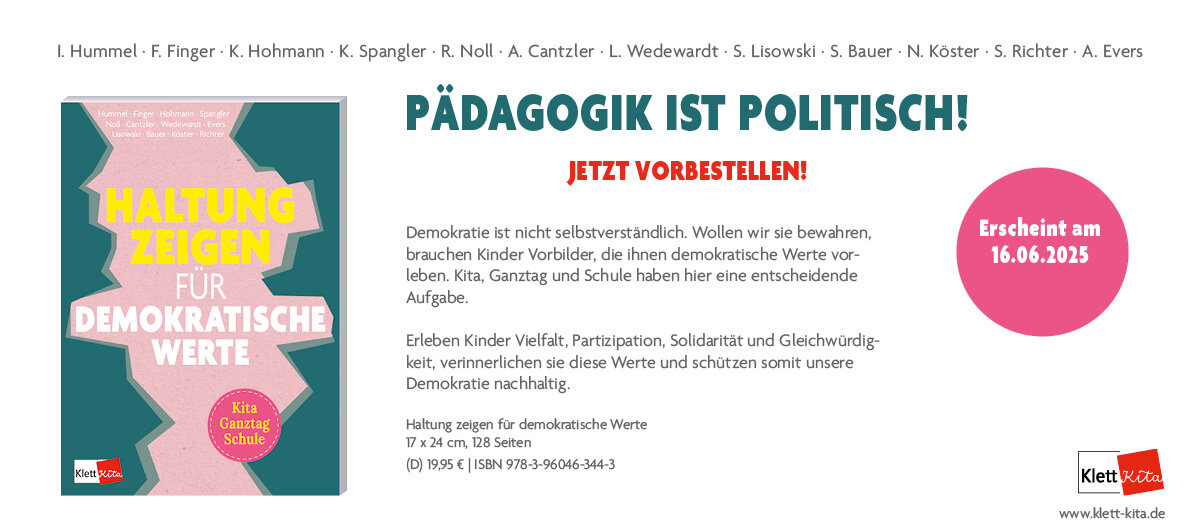
An vielen Stellen erleben wir Vereinfachungen komplexer Themen: Das Internet ist ein guter Ort für eine schnelle Meinung zur Wirtschaftspolitik, zu Lehrplänen oder zur Deutschen Fußballnationalmannschaft. Dabei werden komplexe Inhalte vereinfacht. Oft sind schon die Grundannahmen nicht korrekt, auf denen eine Meinung aufbaut. Der Tenor solcher Äußerungen ist zumeist negativ und destruktiv. Es wird gemeckert und beschuldigt, aber realistische, fachlich versierte Lösungen sucht man vergeblich. Und Altes gilt häufig automatisch als „besser“, neue Wege als Irrungen.
Nun könnte man sagen, wenn irgendwer im Internet postet, ist fehlende Fachlichkeit ja geradezu zu erwarten und unbegründete Rückschlüsse sind im Grunde egal. Die Äußerungen kann man ja einfach ignorieren. Doch diese Art der Kommunikation fördert eine problematische Entwicklung: Denn zum einen gewöhnen Lesende sich an die Verallgemeinerungen und an das Marktschreierische, das nur mit dem Finger auf etwas oder jemanden zeigt, aber trotz Besserwisserei eigentlich nichts Besseres anbietet. Und zum anderen findet diese Art der Kommunikation immer mehr ihren Weg aus Social Media und den Kommentarspalten heraus, hinein in die Realität und macht auch vor der Pädagogik nicht Halt.
So gibt es immer wieder Personen, oft Fachmenschen, aber häufig auch aus ganz anderen Disziplinen (wie Medizin oder Philosophie), die sich pädagogischer Themen annehmen. Sie zerpflücken sie von außen und veröffentlichen Texte und Theorien, vor denen zu warnen ist. Sie bieten teilweise undifferenzierte Inhalte auf der Grundlage einer eigenen, oft fragwürdigen These.
Zum Beispiel wird eine unbelegte Annahme als effektheischend formulierte Tatsache hingestellt:
Solch eine These wird dann ausgeschmückt und unterlegt, entweder mit eigenen Erlebnissen, die nur Anekdoten sind, oder mit Erfahrungsberichten einzelner anderer Personen. Oder aber es werden als Beleg einzelne Studien herausgegriffen, deren Methodiken zuweilen fragwürdig sind oder die nicht durch eine breitere Studienlage gestützt werden können. Außerdem wird die These gern kombiniert mit monokausal aufgebauten Allgemeinplätzen, nach dem Motto „Verhalten X zeigt sich auf Grund von Aspekt Y“, während die Wirklichkeit natürlich nie so simpel ist. Und doch verfangen diese einfachen Erklärungen, weil das Verhalten X eben so herausfordernd ist und eine Lösung gebraucht wird:
Oder die These wird mit Binsenweisheiten kombiniert, die schon lange durch die Pädagogik wabern und sich hartnäckig in den Köpfen halten, obwohl sie nicht stimmen, wie zum Beispiel:
Ein griffiges Beispiel für eine zu einfache, einseitige Sicht ist die Forderung danach, dass Eltern endlich wieder bestimmen sollten, was Kinder anziehen müssten, da sie selbst ja die Wetterlage nicht einschätzen könnten. (vgl. Maas 2021) Hier wird vieles außer Acht gelassen, zum Beispiel Wissen über Wahrnehmungsunterschiede und Neurodivergenz oder über steigende Kooperationsbereitschaft bei Mitsprachemöglichkeiten. Ein anekdotisch beobachtetes Problem (Eltern bringen ihr Kind „unpassend“ angezogen in die Kita und bitten die Fachkraft um Hilfe) wird zu einem allgemeinen Problem gemacht (was Maas schon hinsichtlich seiner Studienlage vorgeworfen wird). Und die Beobachtung und Meinung der Fachkraft über das Elternverhalten ist nicht gesichert abgeklärt und differenziert, sondern kann auch durch Vorurteile gefärbt sein, beispielsweise vielleicht deshalb, weil die Fachkraft auf Grund der Kitakrise keine Kapazitäten zur Unterstützung hat. (vgl. Pichard 2021)
Nebenbei werden häufig im Grunde alle Beteiligten (Eltern, Fachkräfte, Kinder) oder aber die jeweils andere Gruppe schlecht gemacht: „Die sind schuld!“ Und es werden Bilder und Begriffe genutzt, die die Lesenden erst recht dazu einladen, sich bei der Empörung zu beteiligen. Kinder übernehmen den Haushalt, gehen verdreckt über Tisch und Bänke, zeigen aggressive Fratzen und besitzen viel zu viel Spielzeug, es ist von „Helikoptereltern“, „Rasenmäherpädagögik“, „Curlingeltern“, „Arschlochkindern“ und „Tyrannen“ die Rede.
Populistische Ansätze beanspruchen häufig die alleinige Deutungshoheit: Ich weiß es besser und nur mein Weg bringt die Erlösung. Und noch dazu trägt bei diesen „Lösungen“ fast immer der gleiche Personenkreis die Kosten, nämlich die Kinder. Sie „müssen“. Und die Erwachsenen haben vor allem „Schuld“. So wird Druck aufgebaut, der schwerlich konstruktiv genutzt werden kann.
Kinder, Erwachsenen-Kind-Beziehungen, Familien, Entwicklung, Institutionen, pädagogisches Vorgehen – all das ist jedoch komplex und muss komplex gesehen werden. Herausfordernde Verhaltensweisen oder Symptome können sich sehr ähnlich zeigen, aber viele verschiedene Ursachen haben und selten ist es nur eine, sondern meist eine Kombination davon. Die skandalträchtige Verpackung aber zieht die Lesenden in ihren Bann. Man nickt, fühlt sich bestätigt und hat vor allem den Eindruck, endlich könne es eine einfache, eindimensionale und schnelle Lösung geben – das ist Populismus, wie im politischen Bereich auch. Denn so ist unsere Welt nicht.
Auch die wissenschaftliche Pädagogik steht zunehmend in der Gefahr, populistische Tendenzen zu entwickeln, die sich als wissenschaftlicher Diskurs tarnen. Dabei werden etablierte Ansätze wie die bedürfnis- und beziehungsorientierte Pädagogik nicht selten hinterfragt und in manchen Fällen diffamiert. Diese Gefahr entsteht insbesondere dann, wenn Diskurse nicht darauf abzielen, auf wissenschaftlicher Basis unterschiedliche Perspektiven zu integrieren, sondern vielmehr bestehende Ansätze einseitig abzuwerten.
Denn auch von Personen, von denen man so etwas zunächst nicht vermuten würde – zum Beispiel Wissenschaftler:innen pädagogischer Fakultäten – können populistische Narrative verbreitet werden. Auch erscheinen Bücher mit einseitigen, reißerischen Ideen in renommierten Verlagen. Der Anschein wissenschaftlicher Seriosität, verstärkt durch die Reputation eines angesehenen Verlags, kann dazu führen, dass kritische Inhalte unreflektiert aufgenommen werden und manipulative Diskursmuster in der breiteren Debatte stärken. Noch bedenklicher wird es, wenn wir uns verdeutlichen, dass solche Werke als Grundlage für die Ausbildung angehender pädagogischer Fachkräfte herangezogen werden können.
Als Autor:innen und Leser:innen brauchen wir daher ein genaues Hinschauen und die Courage, auf problematische Tendenzen aufmerksam zu machen. Sensitive Reading sollte nicht nur ein methodisches Prinzip sein, sondern auch ein Appell an unser ethisches Verantwortungsbewusstsein. Es gilt, nicht nur kritisch zu analysieren, sondern auch Missstände anzusprechen, um wissenschaftliche Integrität zu wahren.
An die Professor:innen und Herausgeber:innen ist dabei klar zu appellieren, den oftmals vorhandenen Ethikkodex ihrer jeweiligen Fakultäten für ihre Publikationen ernst zu nehmen. Ein solcher Kodex ist dabei nicht nur eine Richtlinie, sondern Ausdruck des Anspruchs, Wissenschaft als Grundlage für konstruktive und verantwortungsbewusste Diskurse zu nutzen – und nicht als Vehikel für destruktive Polarisierung.
Das Initiieren kontroverser Diskussionen ist essenziell, darf aber nicht auf Kosten bewährter pädagogischer Ansätze und wissenschaftlicher Ethik geschehen. Verantwortung und Reflexion müssen auch hier Leitlinien bleiben, um die Glaubwürdigkeit der Pädagogik als Wissenschaft und Praxis zu bewahren. Wenn wir alle genauer hinschauen und uns trauen, Texte zu hinterfragen, die reißerisch und einseitig wirken, egal aus welcher Ecke sie kommen, hat eine solche Art der Pädagogik-Kritik keine Chance.
Literaturverweis
Maas, Rüdiger (09.12.2021): Eltern nehmen ihre Kinder viel zu ernst. https://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2021-09/generationenforscher-ruediger-maas-schueler-deutschland-zufriedenheit-eltern-kindererziehung/komplettansicht [zuletzt abgerufen am: 06.02.2025].
Pichard, Alain (15.11.2021): Die Krux mit den Studien: Diesmal – die Sorge um die Generation Alpha. https://condorcet.ch/2021/11/die-krux-mit-den-studien-diesmal-die-sorge-um-die-generation-alpha/ [zuletzt abgerufen am: 06.02.2025].